


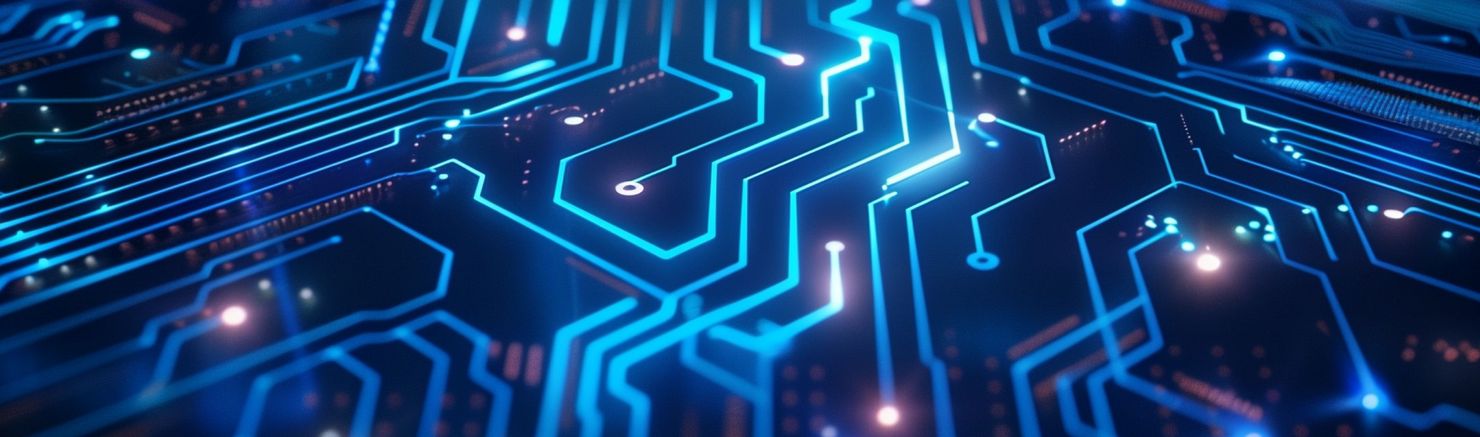
Unter den besten Supercomputern der Welt rangierte im Jahr 2000 ein System aus Bayern auf Platz 5. Der HLRB 1 – der „Höchstleistungsrechner Bayern“ – arbeitete mit 1344 SR 8000-F1-Prozessoren von Hitachi und schaffte damit 1653 GFlop/s, also mehr als 1,6 Milliarden Gleitkommarechnungen pro Sekunde. Es war zwar nicht der erste Supercomputer, den das LRZ betrieb, aber es war der erste, mit dem das bayerische Rechenzentrum ins nationale High Performance Computing (HPC) einstieg: Ein Meilenstein in der mittlerweile 63jährigen Geschichte des LRZ. Diese wurde spätestens 2007 im Verbund mit den Partner-Rechenzentren des Gauss Centre for Supercomputing (GCS) europäischer, internationaler und erzählt von wissenschaftlichen Höchstleistungen und technischen Neuerungen, die noch heute Standards im Supercomputing setzen.
Die Rechenkraft der Supercomputer am LRZ verzehnfachte sich etwa alle vier Jahre, die Speichermenge verdoppelte sich regelmäßig nach gut einem Jahr. Andere Rechenzentren dieser Welt zeigen vergleichbare Entwicklungen: Gemäß dem Moore’schen Gesetz stieg die Rechenleistung der Nummer 1-Systeme in der Top500-Liste alle 14 Monate um 100 Prozent. Doch die Top-Platzierungen aller LRZ-Supercomputer – von HLRB über SuperMUC hin zu SuperMUC-NG – in der weltweiten Bestenliste treten in den Hintergrund beim Anblick der wissenschaftlichen Spitzenleistungen, die diese Supercomputer in den letzten 25 Jahren möglich machten. Sie sorgten unter Wissenschaftlerinnen für Aha-, oft sogar für Wow-Effekte.
Die Schallgrenze wiederum wurde 2021 in der größten interstellaren Turbulenz entdeckt, die ein Team aus Deutschland, den USA und Australien am LRZ modellierte und visualisierte. Deren Wiederholung 2025 dokumentiert den unstillbaren Appetit nach Rechenleistung und Speicherplatz: Gerechnet wurden für beide Simulationen jeweils 100 Snapshots, doch statt 23 belegt die neue durch höhere Auflösung schon 30 Terabyte Hard Drive Space. Arbeiteten vorher 65.000 Rechenkerne, waren jetzt 138.240 aktiv. Verlangte die erste Simulation rund 130 Terabytes an Arbeitsspeicher, so braucht die neue 288 Terabytes. Und Forschende wollen mehr und mehr und mehr rechnen.
Nutzungsdaten des LRZ aus den letzten 25 Jahren bestätigen eindrücklich, dass sich Simulation und Modellierung in den Naturwissenschaften als dritte Säule neben Theorie sowie Experimenten etabliert haben. Hier rechnen nicht nur die klassischen Heavy-User aus Astrophysik, Thermodynamik, Chemie oder Ingenieurswissenschaften, sondern auch Biologinnen, Medizinerinnen, Pharmakologinnen, Klimaforscherinnen sowie Mathematikerinnen und Informatikerinnen.
Diese Vielseitigkeit ist nicht nur die Folge von ausgeklügelter Computertechnik, sondern wurde aktiv gefördert durch das Kompetenznetzwerk für wissenschaftliches Hochleistungsrechnen, KONWIHR. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 arbeitet die vom bayerischen Wissenschaftsministerium geförderte Organisation in Bayern daran, HPC in viel mehr Forschungsdisziplinen zu bringen. Dafür bündelt KONWIHR Fachwissen und HPC-Kompetenz und unterstützt damit Wissenschaftlerinnen bei der Entwicklung und Optimierung von Codes sowie beim Ausreizen von bestehenden Hochleistungscomputern.
In den nächsten Jahren dürfte Künstliche Intelligenz (KI) nicht nur die bayerische HPC-Community bei Simulationen unterstützen; ebenso wird die Zahl interdisziplinärer Projekte weiter zunehmen, denn Hochleistungsrechnen und Digitalisierung vernetzt Wissenschaftsdisziplinen.
Technisch prägt das Ende der Dennard Skalierung die letzten Jahre im HPC, auch das Mooresche Gesetz stößt an Grenzen. Rechenleistungen und Speicherplatz können folglich nicht mehr nur durch eine weitere Verdichtung von Transistoren oder durch die Parallelisierung von noch mehr Prozessoren gesteigert werden, zumal der Energiebedarf von Supercomputern die Möglichkeiten von Rechenzentren allmählich übersteigt. Selbst das Ranking der Top500-Liste spiegelt nur eingeschränkt die Leistung der darin verglichenen Systeme wider. Diese Herausforderungen forcieren das Experimentieren in eigener Sache. Die Forschung am LRZ fokussiert sich daher darauf, nicht das schnellste, sondern das beste System für die Wissenschaft zu haben.
Dem entsprechend entwickelte das LRZ mit Technologiepartner IBM die Kühlung mit heißem Wasser für SuperMUC, der 2012 an den Start ging und optimierte diese später mit Lenovo stetig weiter. Heute steht mit der Ausbauphase des SuperMUC Next Generation, oder kurz SuperMUC-NG, das erste System in den Rechnerräumen des LRZ, das nur mit heißem Wasser kühlt und die Abwärme zur Heizung nutzt. Die Wasserkühlung hat sich im Supercomputing weltweit durchgesetzt und hilft Rechenzentren heute, den Energiebedarf beträchtlich zu senken.
Auch die Konturen einer Zukunft des HPC werden am LRZ sichtbar und deutlicher: So enthält die Erweiterung von SuperMUC-NG, dem aktuellen Supercomputer, neben knapp 27.000 CPU rund 1000 GPU, die das Rechnen beschleunigen und mit statistischen Methoden das HPC und klassische Simulationen bereichern.
Der aktuell leistungsfähigste Computer am LRZ SuperMUC-NG wurde zudem mit Quantencomputern verbunden, die wieder neue Möglichkeiten für Berechnungen bringen. Im Sommer 2025 wurden außerdem erste photonische Prozessoren am LRZ installiert, die statt mit elektrischen Impulsen mit Licht rechnen und nun daraufhin getestet werden, ob sie in einer analog-digitalen Architektur mit Hochleistungsrechnern kooperieren.
25 Jahre nationales HPC in Bayern: Das feierte das LRZ gemeinsam mit den Partnern von KONWIHR sowie mit Gästen aus Wissenschaft, Forschung, Politik und von Partnerunternehmen am 13. Oktober 2025 mit einem Festakt und einem wissenschaftlichen Symposium. Hier Stimmen zum Jubiläum:
„Antrieb unseres Handelns und der eigenen Forschung ist, Wissenschaft schneller zu Erkenntnissen zu führen, die aktuelle Herausforderungen lösen helfen. Ein bisschen stolz sind wir darauf, dass wir im GCS-Verbund das Rechenzentrum für eine sehr breite User-Community sind und uns ganz in den Dienst der Forschung stellen können.“
Prof. Dieter Kranzlmüller, Leiter des LRZ
„Das LRZ hat seit seiner Gründung im Jahr 1962 und insbesondere als nationales HPC-Zentrum immer Spitzentechnologie für seine Nutzercommunity bereitgestellt. Durch seine einzigartige Infrastruktur schuf es gerade im Bereich der Energieeffizienz und der Nutzerfreundlichkeit weltweit beachtete Innovationen .“
Prof. Dr. Arndt Bode, Präsident der Bayerischen Transformations- und Forschungsstiftung und ehemaliger Leiter des LRZ
„Ein breites Spektrum an Anwendungen an der Spitze der Wissenschaft, hohe Kompetenz in allen Bereichen der HPC-Methodenforschung, mit KONWIHR ein bestens etabliertes Unterstützungsnetzwerk für die Wissenschaft, mit NHR@FAU und seinen Systemen eine führende Rolle im nationalen Hochleistungsrechnen und mit dem LRZ ein globaler Player im Höchstleistungsrechnen – Bayern ist in Sachen HPC top aufgestellt im Jubiläumsjahr."
Prof. Hans-Joachim Bungartz, TUM School of Computation, Information and Technology, Direktor LRZ
„HPC und seine Infrastrukturen wurden und werden in Bayern für und mit den Forschenden gedacht und weiterentwickelt. Das LRZ hat sich dabei zu einem internationalen Leuchtturm entwickelt, der hohes Ansehen genießt. Gleichzeitig konnte sich in Erlangen ein weiterer HPC-Hotspot von nationaler Bedeutung etablieren. KONWIHR baut dabei eine starke Brücke zwischen Zentren und Anwendungen sowie Methodenentwicklung und mit Blick auf neue Architekturen und Künstlichen Intelligenzen genauso aktuell und wichtig wie vor 25 Jahren."
Prof. Gerhard Wellein; Department Computer Science, Lehrstuhl High Performance Computing